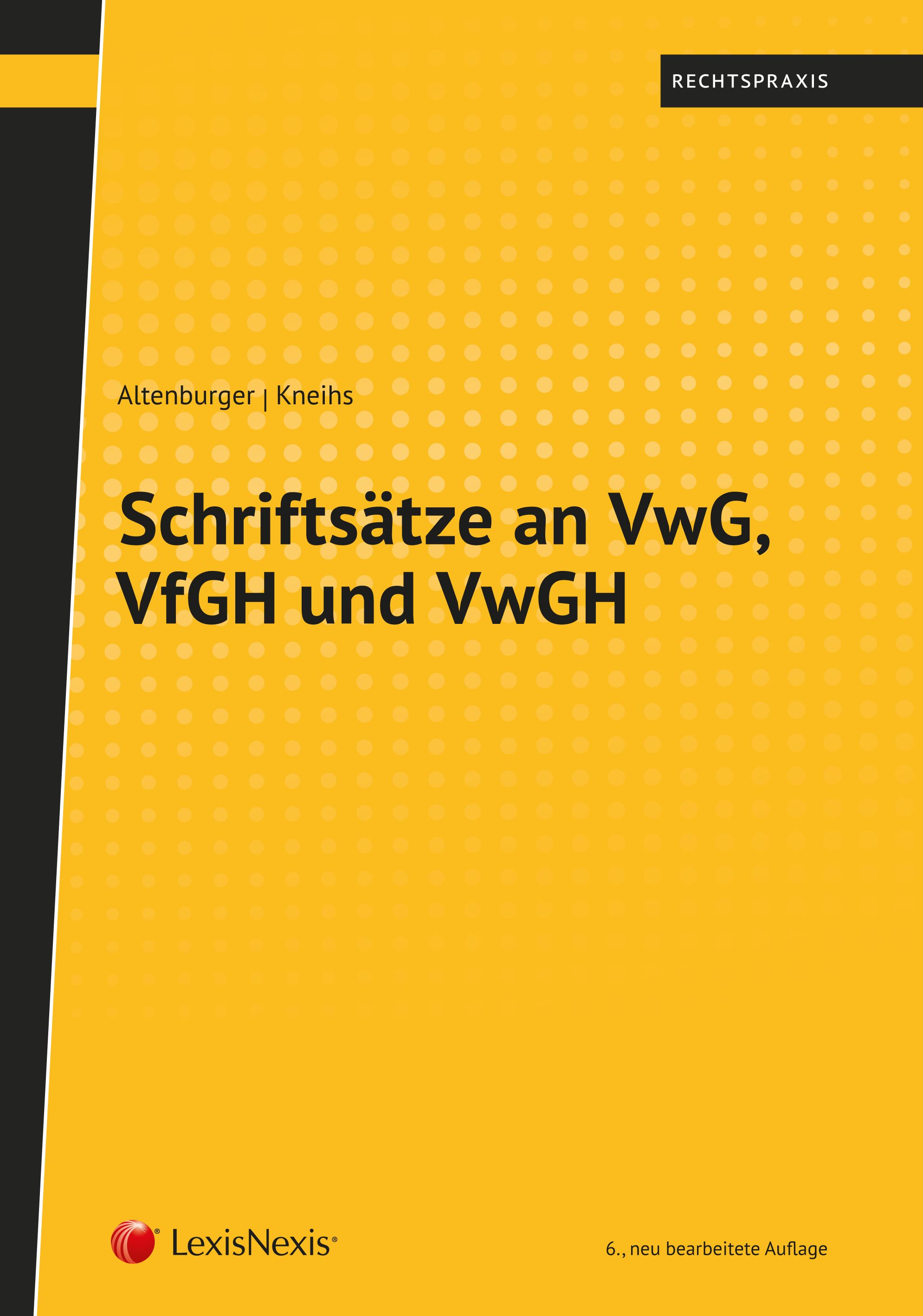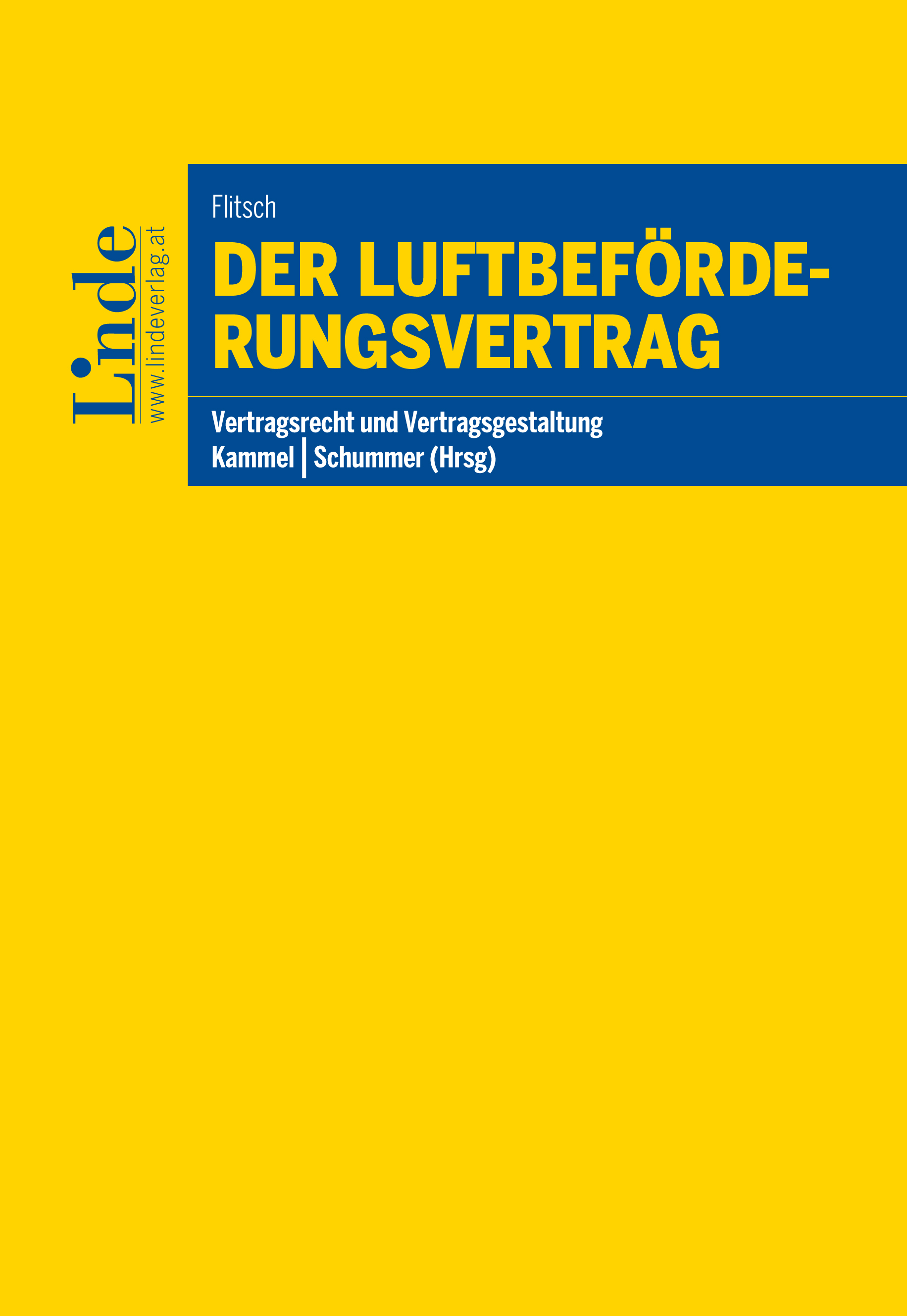Der Neu- und Ausbau von Eisenbahnstrecken führt regelmäßig zur Störung anderer Verkehrsanlagen bzw von Wasserläufen. Während die Anordung in § 20 EisbG, die gestörten Anlagen wiederherzustellen, banal klingt, wirft die Bestimmung in der Praxis zahlreiche Auslegungsfragen auf, die va durch die Schnittstellen zwischen dem Eisenbahnbaurecht, der geannten Anordnung und dem Straßenrecht bedingt sind.
Von Dieter Alteburger, Astrid Bauer und Andreas Netzer
PDF zum Download
Das Erkenntnis des BVwG vom 9.4.2019, W104 2211511-1/53E, ist ein rechtlicher Sprengkörper, dessen Explosion weit über Städtebauprojekte nach dem UVP-G hinaus schallen wird – sollte es vom VwGH bestätigt werden. Das Judikat erschüttert die Grundfesten des UVP-G-Rechtsanwenders gleich in sowohl materiell-rechtlicher als auch in verfahrensrechtlicher Hinsicht.
Materiell-rechtliche Aspekte des Erkenntnisses:
Schriftsätze an VwG, VfGH und VwGH widmet sich seit 2008 der Vermittlung der Inhalte des verfassungs- und verwaltungsgerichtlichen Verfahrens und hat sich mittlerweile bei den öffentlich rechtlichen Schriftsatzmustern als Standardliteratur etabliert. Das Werk ist soeben in 6. Auflage erschienen.
Der Fokus der einzelnen Kapitel liegt auf einer ebenso übersichtlichen wie knappen Darstellung, die dennoch sehr weite Bereiche dieser Thematik abdeckt. Anhand von Schriftsatzmustern werden die einzelnen Punkte von Schriftsätzen an die Verwaltungsgerichte, den Verfassungsgerichtshof bzw den Verwaltungsgerichtshof in chronologischer Reihenfolge abgehandelt. Der Leser kann seinen eigenen Schriftsatz daran orientierend Schritt für Schritt aufbauen. Die Autoren runden den Leitfaden durch ausgeführte Schriftsätze ab.
Die aktuelle Neuauflage berücksichtigt dabei insbesondere die seit dem Inkrafttreten der Verwaltungsgerichtsbarkeitsnovelle ergangene, umfangreiche Rechtsprechung zu den Bestimmungen des VwGVG sowie dem Verhältnis der Verwaltungsgerichte zu den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts
Vortrag Mag. Nadia Kuzmanov und Dr. Marcel Singer, Innsbruck 18.4.2017
Fallstricke im Vergaberecht
ÖJZ 2016/147
Dem Fortführungsantrag kommt mit jährlich weit über 2.000 eingebrachten Anträgen große praktische Bedeutung zu. Dennoch gibt es bisher keine empirischen Daten zu seiner Wirksamkeit. In einer Untersuchung wurde nun unter anderem erhoben, inwieweit positiv entschiedene Fortführungsanträge letzlich zu einem anderen Ausgang des Strafverfahrens führen.
Nicht zuletzt aufgrund einer Unzahl von Kapitalmarktverfahren zur Geltendmachung tatsächlicher oder vermeintlicher Ansprüche gegen Finanzinstitute und die dadurch bedingte völlige Überlastung einzelner Gerichte, wurde der Ruf nach verfahrensrationalisierenden Schritten immer lauter.
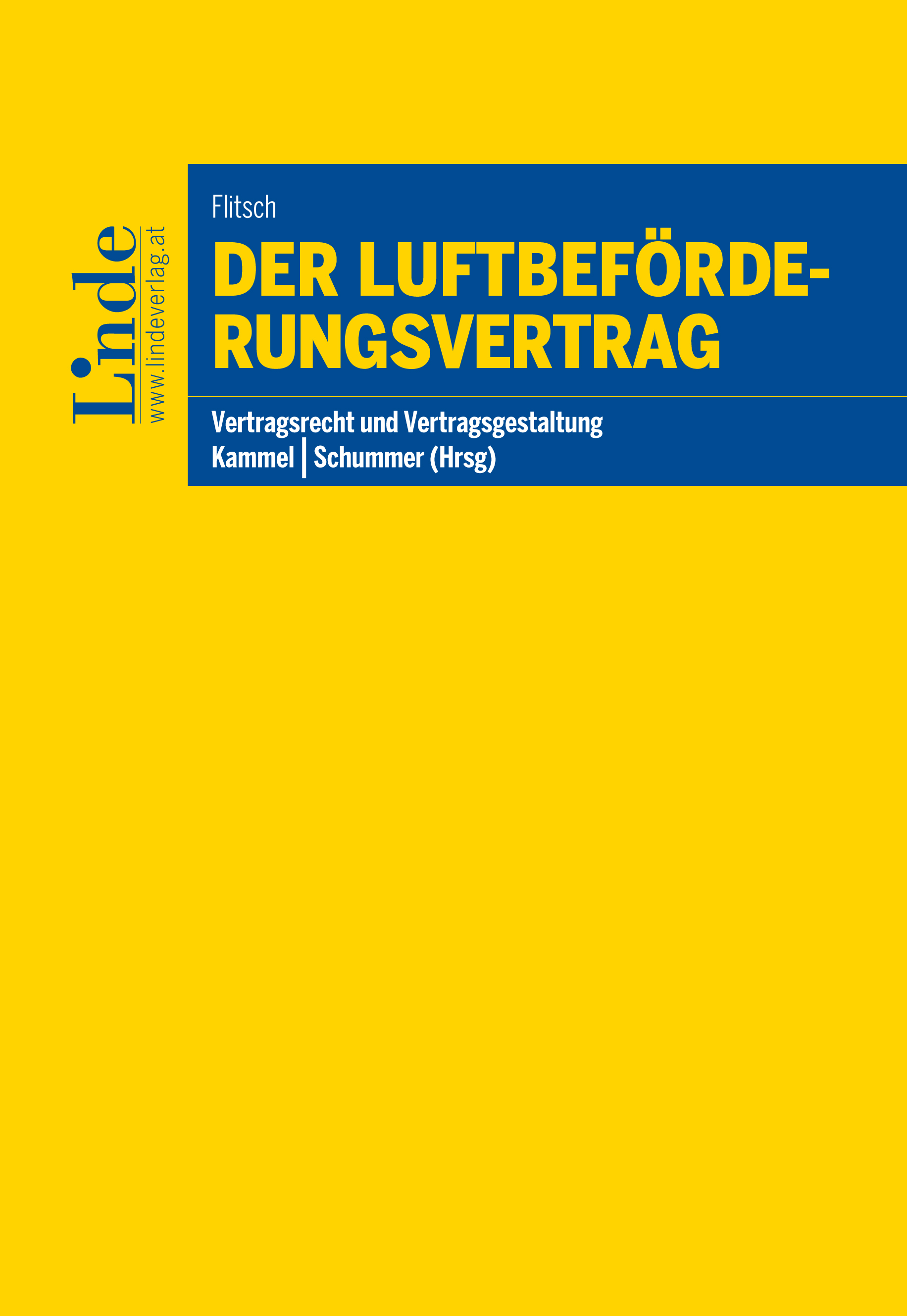
Einen fundierten und praxisnahen Überblick über die wesentlichen Aspekte des Luftbeförderungsvertrages bietet dieser Band aus der Reihe Vertragsrecht und Vertragsgestaltung. Mit dem Schwerpunkt Personenbeförderung, werden unter anderem folgende Themen behandelt:
- Nationale, unionsrechtliche und völkerrechtliche Grundlagen
- Vertragsparteien des Luftbeförderungsvertrages
- Vertragsabschluss und Vertragsdokumentation (Ticket, Allgemeine Beförderungsbedingungen etc)
- Rechte und Pflichten der Passagiere und der Fluglinie
- Leistungsstörungen (Verspätungen, Flugausfälle etc)
- Haftungsregelungen in den verschiedenen rechtlichen Grundlagen
Dargestellt werden diese Punkte anhand der Allgemeinen Beförderungsbedingungen von Fluglinien.
Öffentlichkeitsbeteiligung im Umbruch
Zwei Entscheidungen des EuGH haben grundlegenden Einfluss
auf die Rechte der Nachbarn bzw der betroffenen Öffentlichkeit in
Umweltverfahren. Zwei Entscheidungen, die, wie es in der Natur der
EuGH-Entscheidungen liegt, viele Fragen aufgeworfen haben. Zwei Entscheidungen,
die uns daher für die gegenständliche Diskussionsreihe äußerst geeignet
erschienen.
1. Karoline Gruber
2. Kommission/Deutschland
Lärmrecht in Bewegung
Die Judikatur hat in den letzten Jahren für einige Bewegung bei der rechtlichen Beurteilung von Lärmimmissionen gesorgt.
Eine der letzten Hinterlassenschaften des Umweltsenates war die Entscheidung Wieselburg. Der Verfassungsgerichtshof hat sich mit der Gesetzmäßigkeit der SchIV beschäftigt und diese partiell als veraltet aufgehoben. Der BMVIT als Verordnungsgeber hat in den Jahren 2012 und 2014 zwei besondere Immissionsschutzvorschriften erlassen, die Luftverkehr-Lärmimmissionsschutzverordnung und die Bundesstraßen-Lärmimmissionsschutzverordnung. Ungefähr zur gleichen Zeit gab es auch noch zwei Erkenntnisse des VwGH, Koralmbahn und Semmering-Basistunnel. Aktuell hat das Bundesverwaltungsgericht einen Antrag auf Aufhebung von Teilen der BStLärmIV als gesetzwidrig gestellt.
Zusammenfassen lassen sich diese Entwicklungen mit der Einsicht, dass viele Dinge im Wandel und viele nach wie vor unklar sind; wo muss ich messen, wann besteht Freiraumschutz, bricht eine Verordnung den Freiraumschutz oder ist eine Verordnung, die den Freiraumschutz beseitigt,
vielmehr bedenklich?
von Mag. Stefan Rust und Mag. Theresa Gaismayer
Viele aus der Erstfassung des EAVG resultierende Fragen wurden mit der Neufassung durch den Gesetzgeber konkretisiert. Doch sind damit alle Fragen beantwortet?