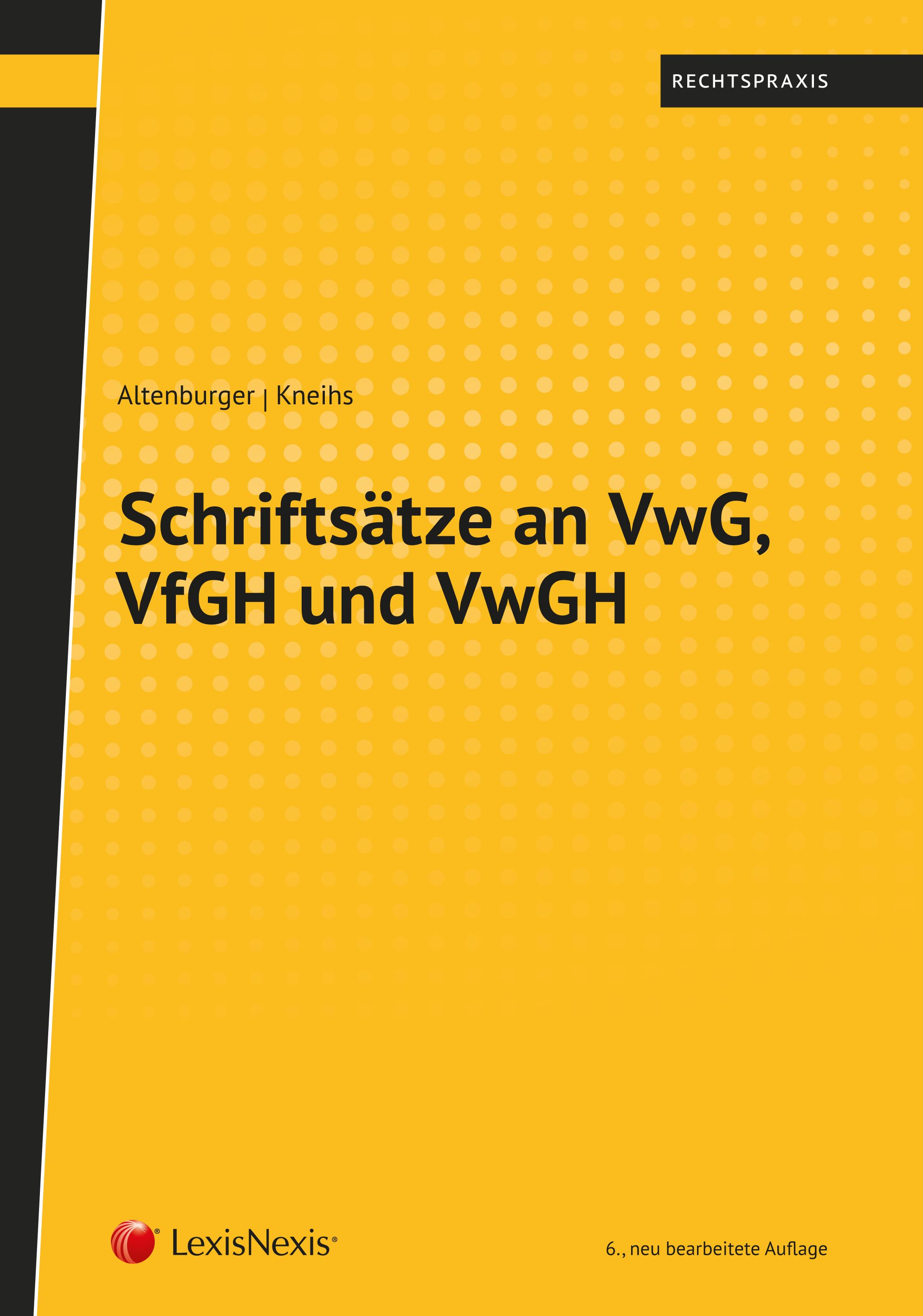Der NÖ Umweltanwalt brachte in seiner Beschwerde vor, dass die Behörde im Hinblick auf die Ausführungen zur Kumulierung im fortgesetzten Verfahren und bei Erlassung des neuen Bescheides nicht an die rechtliche Beurteilung des BVwG in seinem Zurückverweisungsbeschluss gebunden sei, da sich das Gericht nicht auf tragende Aufhebungsgründe stützte.
(VwGH 20.12.2017, Ra 2017/04/0060)
Die Revisionswerberin stellte mit 8.4.2014 den Antrag auf Erlassung geeigneter Maßnahmen zur schnellstmöglichen Einhaltung der Immissionsgrenzwerte für NO2 im Land Salzburg, brachte vor, dass die bisher im Luftreinhalteprogramm des Landeshauptmannes vom 22. September 2008 und in der Fortschreibung des Luftreinhalteprogrammes 2013 nach § 9a IG-L angekündigten Maßnahmen sowie die nach §§ 10 ff IG-L tatsächlich erlassenen Maßnahmen unzureichend seien und bezog sich dabei auf die Vorschrift zur Erlassung geeigneter Maßnahmen im Sinne der Luftqualitäts-RL 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2008 über Luftqualität und saubere Luft für Europa und des Immissionsschutzgesetzes-Luft (IG-L). Der verfahrenseinleitende Antrag ist dahingehend auszulegen, dass die Revisionswerberin damit eine gegen umweltbezogene Bestimmungen verstoßende Unterlassung der Behörden iSd Art 9 Abs 3Aarhus-Konvention (AK) geltend mache.
Der Fokus der einzelnen Kapitel liegt auf einer ebenso übersichtlichen wie knappen Darstellung, die dennoch sehr weite Bereiche dieser Thematik abdeckt. Anhand von Schriftsatzmustern werden die einzelnen Punkte von Schriftsätzen an die Verwaltungsgerichte, den Verfassungsgerichtshof bzw den Verwaltungsgerichtshof in chronologischer Reihenfolge abgehandelt. Der Leser kann seinen eigenen Schriftsatz daran orientierend Schritt für Schritt aufbauen. Die Autoren runden den Leitfaden durch ausgeführte Schriftsätze ab.
Die aktuelle Neuauflage berücksichtigt dabei insbesondere die seit dem Inkrafttreten der Verwaltungsgerichtsbarkeitsnovelle ergangene, umfangreiche Rechtsprechung zu den Bestimmungen des VwGVG sowie dem Verhältnis der Verwaltungsgerichte zu den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts.
Bereits die Vorinstanzen entschieden, dass ein (wenn auch verhältnismäßig geringer) Teil der Ablöse (zulässigerweise) für etwaige Ausstattungsgegenstände übernommen wurde und daher nicht zurückgefordert werden kann. Der Revisionsrekurs des Vormieters richtete sich sohin nur gegen den stattgebenden Teil des Urteils.
Mit Erkenntnis vom 17. November 2017 entschied das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) über die Beschwerde gegen einen Bescheid der Steiermärkischen Landesregierung mit dem festgestellt wurde, dass für das Vorhaben der Errichtung eines Stallgebäudes für 1250 Mastschweine, 208 Zuchtsauen und 840 Ferkel keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen sei. Das BVwG hat die Beschwerde abgewiesen und sich ausführlich mit den relevanten rechtlichen Fragestellungen befasst.
(EuGH 07.09.2017, C-559/16)
Dieter Altenburger und Georg Schwarzmann liefern in der 5. Auflage der Aviation Law Review einen Überblick über die österreichische Rechtslage betreffend Luftverkehrsrecht.
RSS Feed abonnieren: